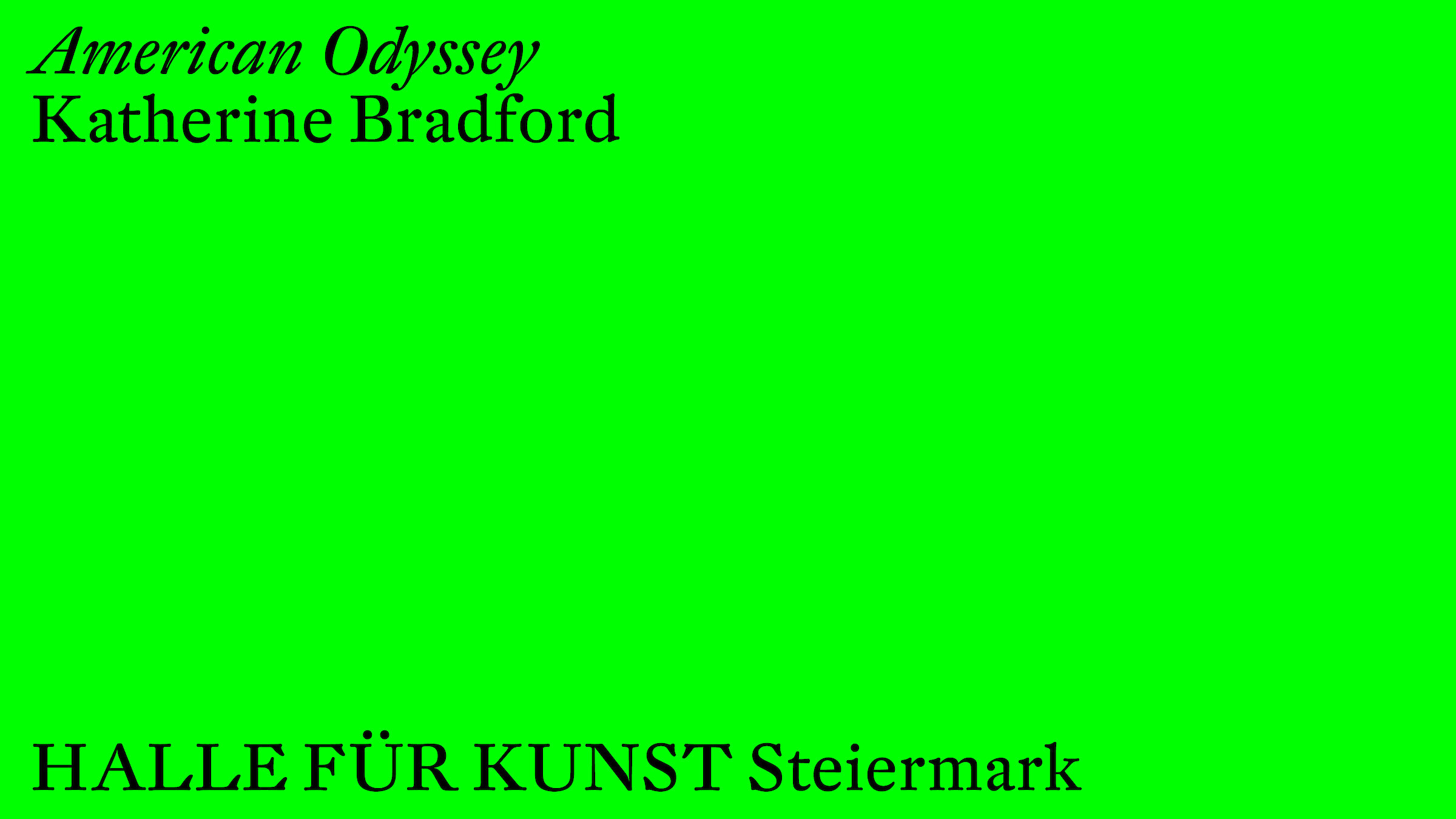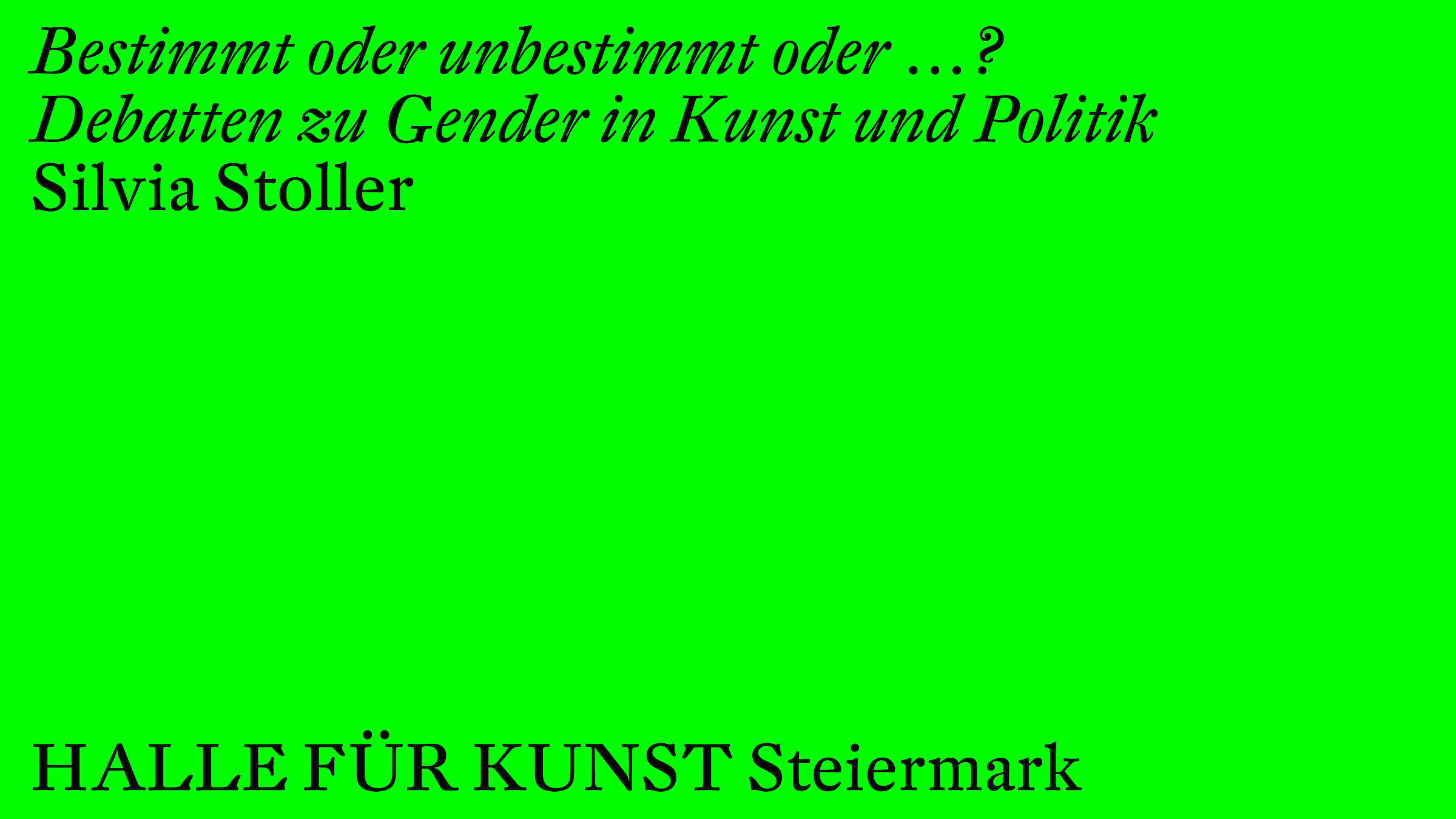Politische Gleichheit
Danielle Allen
Leseprobe
Danielle Allen, Politische Gleichheit, Suhrkamp, Berlin 2020
Please note that this text is only available in German.
Erstes Kapitel
Einleitung: Politische Gleichheit und ökonomische Ermächtigung
Die große Wirtschaftskrise des Jahres 2008, Thomas Pikettys Kapital im 21. Jahrhundert und welterschütternde Wahlausgänge während der letzten vier Jahre in den USA, in Großbritannien und ganz Europa haben nicht nur in den Augen von Ökonomen, sondern für jedermann Fragen der politischen Ökonomie, der Einwanderung und bezüglich deren Verflechtung auf die Tagesordnung gesetzt. Sind die politischen Überraschungen der letzten Jahre auf den dramatischen Anstieg der Einkommens- und Vermögensungleichheit in den entwickelten Ländern und auf die plötzlich auseinanderdriftenden Schicksale der Menschen mit und ohne Universitätsausbildung zurückzuführen? Es hat viele Rufe nach einem Überdenken unserer Herangehensweise an die politische Ökonomie gegeben. Doch im Grunde genommen geht eine Neuerfindung der politischen Ökonomie zwingend über den ökonomischen Rahmen hinaus. Meiner Ansicht nach haben die Ökonomen die Fragen beantwortet, die ihnen von politischen Philosophen und der allgemeinen Öffentlichkeit gestellt worden sind. Wenn wir andere Antworten möchten, müssen wir uns andere Fragen einfallen lassen. Ziel dieses Buches – ursprünglich einer Reihe von Adorno-Vorlesungen – ist es, neue Fragestellungen anzuregen, insbesondere in Bezug auf politische Gleichheit.
Zuhörer – bzw. Leser – zum Nachdenken über einen so hochabstrakten Begriff wie politische Gleichheit aufzufordern, ist ein bisschen so, als würde man eine Lehrveranstaltung um acht Uhr morgens ansetzen. So sorgt man gewissermaßen dafür, dass diejenigen, die kommen bzw. nicht bloß die Einleitung lesen, auf etwas Ernsthaftes gefasst sind. Ist dies der Fall, hoffe ich, eine Reise in die politische Philosophie und Überlegungen über ein paar der Grundbegriffe anbieten zu können, die Demokratie und demokratische Bestrebungen definieren. Meines Erachtens geht ein großer Teil der Erfahrungen, die wir heute auf so verschiedenartigen Gebieten wie dem Politischen, Sozialen und Ökonomischen machen, auf Denkfehler zurück, die uns in den letzten Jahrzehnten regelmäßig unterlaufen sind und deren Ursprünge noch weiter in die Tradition der politischen Philosophie zurückreichen. Diese Fehler möchte ich korrigieren. Das heißt, ich bin der Meinung, dass sowohl ein Verständnis der jüngsten Ereignisse als auch die Grundsteinlegung für eine neue politische Ökonomie von uns eine Reise zurück in die Tradition der politischen Philosophie verlangen. Allerdings lade ich vor allem deshalb zu einer solchen Reise ein, um – sowohl am Ende der Einleitung zu diesem Buch als auch an seinem Schluss – auf die konkreten politischen und ökonomischen Gegebenheiten zurückzukommen.
In der heutigen Welt lässt das Anführen von politischer Gleichheit (in den USA) meistens unmittelbar an tagesaktuelle Herausforderungen wie die Reform der Wahlkampffinanzierung, die Entrechtung von Straftätern und die Gesetze zur Wähleridentifizierung denken. In Europa ruft das Thema Probleme der Funktion von Parteien, der Zugehörigkeit und der Demokratiedefizite bei Abläufen in der Europäischen Union auf den Plan. Wenn man vor einigen Jahren jemanden gefragt hätte, worum es bei politischer Gleichheit vorrangig gehe, wäre meiner Meinung nach diese Art von Problemen als Antwort angeboten worden. Doch das war, bevor wir alle ernsthaft von den Ereignissen wie zum Beispiel der Wahl von Donald Trump und dem Brexit oder auch davon überrascht worden sind, wie die Flüchtlingskrise die deutsche Politik auf den Kopf gestellt hat. Tatsächlich dürfte der beste Weg zum Verständnis, worum es grundsätzlich bei politischer Gleichheit geht, in einer Untersuchung der Frage bestehen, warum uns jene Ereignisse so überrascht haben. Eine solche Fragestellung fördert zutage, dass die in den letzten Jahrzehnten gebräuchlichen politischen Paradigmen blinde Flecken aufweisen, die unsere Überraschung erklären. Ich bin der Meinung, dass eine Verlagerung unserer Aufmerksamkeit auf politische Gleichheit, und zwar auf eine gehaltvollere Auffassung von politischer Gleichheit dazu beiträgt, diese blinden Flecken zu beheben. Im Folgenden werde ich versuchen, die blinden Flecken in den heute vorherrschenden politischen Paradigmen zu identifizieren und zu erklären – und ich werde ein alternatives Paradigma vorschlagen, wie man über ökonomische Fragen nachdenken könnte. Wie wir sehen werden, macht dieses alternative Paradigma denn auch eine umfassende Neuordnung der politischen Agenden erforderlich. Kurz gesagt, bemüht sich dieses kleine Buch darum, den Grundstein für eine Neuorganisation der politischen Debatten über den Wert von politischer Gleichheit zu legen.
I. Ein blinder Fleck im 20. Jahrhundert
Natürlich haben uns nicht nur der Brexit, Trump und das Wanken von Angela Merkels Autorität überrascht, sondern auch die Wirtschaftskrise des Jahres 2008. Aus diesem Grund leben wir schon seit fast zehn Jahren in einem intellektuellen Überraschungszustand. Warum haben wir uns so überrumpeln lassen? Meiner Meinung nach liegt die Antwort in den tonangebenden liberalen Paradigmen der Politikgestaltung.
Im tonangebenden liberalen politischen Paradigma, das seinen Ausgang von Orten wie Harvards Kennedy School of Government nimmt und in den Washingtoner Think Tanks und Politikgestaltungszirkeln verfochten wird, verschmelzen zwei Dinge: utilitaristisches ökonomisches Wohlfahrtsdenken und rawlsianisches Wohlfahrtsdenken. Dies möchte ich kurz erklären.
Nach dem utilitaristischen Modell besteht das politische Ziel in der Maximierung des Glücks, besser gesagt des Nutzens, wie die Ökonomen sagen, für die Gesellschaft. In seiner krudesten Form stützt sich das Bemühen, den Gesamtnutzen zu maximieren, auf Kosten-Nutzen-Analysen in Verbindung mit Präferenzen, die sich normalerweise an materiellen Gütern festmachen. Viele Modelle der Nutzenmaximierung im Zusammenhang mit Präferenzen abstrahieren von den kontextbezogenen, sozialen, psychologischen und kulturellen Partikularitäten individueller ökonomischer Akteure. Das Streben nach utilitaristischer Wohlfahrtsmaximierung konzentriert sich gewöhnlich auf die Maximierung des Gesamtwachstums – im Hinblick auf Einkommen und Vermögen – und auf die Inanspruchnahme von politischen Umverteilungsmaßnahmen bei der Ausschüttung dieses Wachstums.
Unter dem Titel Eine Theorie der Gerechtigkeit hat der Philosoph John Rawls im Jahr 1971 ein wichtiges Buch veröffentlicht und eines seiner Hauptziele war die Überwindung des Utilitarismus. Sein Versuch, nicht das Streben nach irgendeinem Einzelgut, nicht einmal nach Nutzen oder Glück, sondern den Schutz der rechtlichen Rahmenbedingungen zum Zweck der politischen Ordnung zu machen, war darum bemüht, dem Recht höhere Priorität als dem Guten einzuräumen. Doch obwohl er philosophisch gesehen die Überwindung des Utilitarismus anstrebte, hat der Rawlsianismus in vielerlei Hinsichten dessen praktische Anwendungsmöglichkeiten erhöht.
Nach dem Rawlsschen Modell besteht das Ziel einer gerechten Gesellschaft in zwei Dingen: Das erste Ziel ist der Schutz einer Reihe von Grundfreiheiten. Zu diesen Grundfreiheiten gehören Dinge wie das Vereinigungsrecht, das Recht auf freie Meinungsäußerung und das Recht auf politische Teilhabe bzw. Partizipation. Das zweite Ziel ist das Streben nach sozialen und ökonomischen Strukturen innerhalb des durch den Schutz dieser Rechte vorgegebenen Rahmens, die den in der Gesellschaft am schlechtesten Gestellten zu Gute kommen (»Differenzprinzip«) und in der Gesamtgesellschaft faire Chancengleichheit gewährleisten.
An Rawls’ neuartigem und einflussreichem Differenzprinzip hat sich ein Großteil der Rezeption seines Werkes festgemacht. In den philosophischen Diskussionen über Gerechtigkeit hat dies dazu geführt, dass der Hauptschwerpunkt auf ökonomischen Fragen der Verteilungsgerechtigkeit lag. Diesen Fragen wurde weit mehr Aufmerksamkeit geschenkt als Rawls’Auseinandersetzung mit den Grundrechten. In der Welt der Politik hat der Rawlsianismus denn auch zu einer grundsätzlichen Konzentration auf steuerliche Umverteilung als Ausgangspunkt für die politische Rahmenbildung geführt. Ohne dies zu beabsichtigen, hat Rawls das utilitaristische Paradigma eben dadurch verstärkt, dass er durch das Differenzprinzip die Betrachtung der Grundrechte von seinen Überlegungen zur sozialen und ökonomischen Sphäre abgekoppelt hat. Soweit sie mit Umverteilung verbunden war, förderte Rawls’Ansatz die utilitaristische Konzentration auf das Wachstum.
So wie sie sich in der Welt der Politik niederschlagen, ist materielle Verteilung sowohl im utilitaristischen Wohlfahrtsdenken als auch im rawlsianischen Wohlfahrtsdenken die Kernfrage im Hinblick auf Gerechtigkeit. Dies ist leicht erkennbar. Wenn jemand sich auf den Begriff »soziale Gerechtigkeit« beruft, sind Fragen der ökonomischen Verteilung und der sozialen Wohlfahrtsrechte wahrscheinlich das erste, was einem in den Sinn kommt. Und wenn jemand umgekehrt auf den Begriff der Ungleichheit zu sprechen kommt, ist die Art von Ungleichheit, an die er dabei denkt, fast ausnahmslos ökonomische Ungleichheit. Damit kennen Wissenschaftler und die allgemeine Öffentlichkeit sich dank der intellektuellen Schützenhilfe durch politische Paradigmen aus, die zum einen auf das utilitaristische Wohlfahrtsdenken und zum anderen auf das rawlsianische Wohlfahrtsdenken zurückgehen.
Zwei Eigenschaften dieses vereinigten utilitaristisch-rawlsianischen politischen Paradigmas verdienen Aufmerksamkeit. Erstens nehmen sowohl das utilitaristische Paradigma als auch das rawlsianische Paradigma Universalisierungen vor. Das heißt, beide abstrahieren von den kontextbezogenen Eigentümlichkeiten einer konkreten Gesellschaft, um ihre übergeordneten politischen Leitlinien zu entwickeln (Nutzenmaximierung auf der einen und Differenzprinzip auf der anderen Seite). In seiner Theorie der Gerechtigkeit macht John Rawls sich zum Beispiel auf die Suche nach der Definition des Rechten, indem er von uns verlangt, uns in der Vorstellung hinter »einen Schleier des Nichtwissens« zu begeben, hinter dem wir nichts mehr über unsere eigene soziale Lage wissen; aus der Perspektive dieser Vorstellung sollen wir dann versuchen, die Prinzipien zu erkennen, die eine gerechte Gesellschaft ausmachen, welche wir unabhängig davon als solche betrachten würden, ob wir in dieser Gesellschaft zu den Wohlhabenderen oder zu den Ärmeren gehören, ob wir männlich sind oder weiblich, schwarz oder weiß, Christen, Buddhisten, Muslime, Juden, Hindus, Atheisten oder Agnostiker und so weiter. Die Gerechtigkeitsprinzipien müssen ungeachtet aller einer Gesellschaft zugrunde liegenden demografischen Merkmale ausgearbeitet werden. Zudem sollen sie universelle Geltung besitzen, das heißt sich auf jeden sozialen Kontext anwenden lassen.
Im utilitaristischen Kontext geht das Abstrahieren von sozialer Partikularität nicht unbedingt auf ein gezieltes Theoriedesign zurück, sondern stellt eher eine notwendige Folge der utilitaristischen Mathematisierung dar. Nutzen ist ein Begriff, der grundsätzlich nicht bloß die bestehenden Präferenzen von Akteurinnen und Akteuren für materielle Ergebnisse abdecken kann, sondern auch ihre Werte und Normen. Aber das Ziel einer »Maximierung« des Nutzens macht eine Umrechnung der Präferenzen in etwas Arithmetisches erforderlich und deshalb dienen gewöhnlich finanzielle Interessen als Stellvertreter für den Nutzen, wodurch die partikularen Präferenzen eingeebnet werden, die dem Leben der einzelnen Akteurinnen und Akteure womöglich erst Sinn und Form verleihen. Wie bei Rawls erlaubt der Schritt, materiellen Gewinn bzw. Geld als Stellvertreter für den Nutzen zu verwenden, eine Universalisierung. Finanzieller Einsatz lässt sich in Zahlungsmittel übersetzen und land- und kontextübergreifend vergleichen, ohne dass auf die örtlichen demografischen Faktoren oder Bedingungen in einem konkreten Land Bezug genommen werden müsste. Beide intellektuellen Paradigmen ziehen mit anderen Worten unter anderem unsere Aufmerksamkeit von den demografischen und institutionellen Modalitäten ab, die einer Gesellschaft zugrunde liegen. So kommen wir gar nicht mehr auf den Gedanken, Fragen danach zu stellen, wer Macht hat und auf welchen institutionellen Strukturen und welcher Art von Ressourcenallokation und Chancenzuweisung sie beruht. In dem Maße, wie wir uns verstärkt ein utilitaristisches und / oder rawlsianisches Wohlfahrtsdenken angewöhnen, verlieren wir die Angewohnheit, die demografischen und politischen Eigentümlichkeiten einer konkreten Gesellschaft zu analysieren.
Als konkretes Beispiel für die Art von Abstraktion, auf die ich hinauswill, kann man die historische Vorgehensweise der Weltbank im späten 20. Jahrhundert heranziehen. Eine Reihe von Standardbausteinen für ökonomische Liberalisierung wurde gegenüber sich entwickelnden Volkswirtschaften zur Bedingung dafür gemacht, dass sie Darlehen von der Bank erhielten.
Dass die Stabilität dieser politischen Paradigmen des Wohlfahrtsdenkens uns dazu verleitet hat, die ihnen zugrunde liegenden sozialen und politischen Phänomene nicht zu beachten, rührt meiner Meinung nach von einem kleinen philosophischen Fehler her, der im frühen 19. Jahrhundert begangen wurde und seitdem die meisten Varianten des Liberalismus gekennzeichnet hat. Der Fehler bestand darin, dass zwei Hälften der vom Liberalismus zu wahrenden Grundrechte unterschieden wurden. Den Begriff der Grundrechte habe ich eingeführt, als ich Rawls’ Theorie der Gerechtigkeit beschrieb, und als Beispiele habe ich Vereinigungsfreiheit, freie Meinungsäußerung und das Recht auf politische Teilhabe bzw. Partizipation genannt. Mit diesen drei Beispielen habe ich das volle Spektrum der Grundrechte unter Einbeziehung beider im frühen 19. Jahrhundert unterschiedenen Hälften abgebildet.
Was genau soll das heißen? Der französische Denker Benjamin Constant gehörte im frühen 19. Jahrhundert zu den ersten, die Grundrechte, grundlegende Menschenrechte, in zwei Kategorien unterteilt haben. Er bezeichnete sie als Rechte der Alten und als Rechte der Heutigen, also der Modernen. Zu den Rechten der Alten gehörten die Rechte auf politische Teilhabe, das Recht, das gemeinsame Leben in einer Gesellschaft zu gestalten. Wir nennen diese Rechte heute positive Freiheiten. Zu den Rechten der Modernen gehören dagegen das Recht auf Eigentum und das Recht, sich das Eigentum, auf das man ein Recht hat, unbehelligt anzueignen und im Streben nach dem eigenen Wohl nach Gutdünken geschäftliche Transaktionen vorzunehmen. Diese Rechte nennen wir negative Freiheiten.
Die Rechte der Alten waren politische Rechte – das Recht, Teil einer Gesellschaft zu sein, die durch kollektive Entscheidungsfindung gemeinsam den eigenen Kurs festlegte. In den Rechten der Modernen ging es in Constants Augen um private Autonomie: Man hatte das Recht, den Kurs des eigenen Lebens festzulegen und dabei im Großen und Ganzen von jeglicher kollektiver Entscheidungsfindung so weit wie möglich unbehelligt gelassen zu werden.
Diese Unterscheidung ist in die philosophische Tradition eingegangen und wurde im frühen 20. Jahrhundert von Isaiah Berlin ausgeweitet (der die Begriffe negative und positive Freiheit eingeführt hat). In seiner Theorie der Gerechtigkeit behauptet Rawls, er habe die beiden Arten von Rechten wieder zusammengeführt und dass wir die gesamte Palette der Grundrechte schützen müssten. Tatsächlich sind die politischen Rechte aber letzten Endes für seine Argumentation entbehrlich, wie ich ausführlich in Kapitel 2, »Differenz ohne Herrschaft«, untersuchen werde. Was den großen Bogen der Theorie der Gerechtigkeit anbelangt, konzentriert sich unser politisches Denken letztendlich in erster Line auf die Verknüpfung unserer persönlichen Rechte (das Recht auf Autonomie, Eigentum,Vereinigung, Meinungsäußerung und so weiter) mit den mit diesen Rechten verbundenen ökonomischen Fragen: dem mit dem Eigentum verbundenen Vermögen und dem Umverteilungsbedarf, der sich aus dem ungleichen Fließen der Produktivitätsgewinne innerhalb einer Gesamtbevölkerung ergibt. Wenn man die politischen Rechte aus dem Blick verliert und sich in erster Linie auf die persönlichen Rechte oder negativen Freiheiten konzentriert, richtet man mit anderen Worten sein Augenmerk leicht ausschließlich auf ökonomische Fragen und verliert die politischen Fragen aus dem Blick. Dies ist meiner Meinung nach in den politischen Paradigmen geschehen, die im späten 20. Jahrhundert die politische Entscheidungsfindung in den liberalen Demokratien dominiert haben.
Die Entwicklung einer verkürzten – die zugrunde liegenden politischen Fragen außer Acht lassenden – Aufmerksamkeit für ökonomische Fragen hat außerdem damit zu tun, dass der Einfluss des Rechts auf die öffentliche Ordnung im Laufe des 20. Jahrhunderts auf die Ökonomie übergegangen ist. Die Soziologin Elizabeth Popp Berman1 hat die verschiedenen Faktoren gut erfasst – zu denen auch neue Rechenkapazitäten gehören –, die hinter diesem Wandel standen und es ließe sich noch sehr viel mehr über diesen Übergang vom Recht zur Ökonomie sagen. Aber er untermauert auch das, worauf ich hinauswill. Rechtliche Erwägungen betreffen grundsätzlich die Institutionen spezifischer Gesellschaften und die Folgen dieser institutionellen Partikularitäten für die spezifische Gesellschaft, in der sie anzutreffen sind. Selbst Subdisziplinen wie die Rechtsvergleichung, die Rechtssysteme an verschiedenen Orten vergleicht, müssen zu Beginn die Spezifität der Rechtsinstitutionen an jedem der zum Vergleich stehenden Orte zur Kenntnis nehmen. Als das Recht die politische Entscheidungsfindung dominierte, gab es kaum Universalisierungen vornehmende Herangehensweisen an die Politik, die von den demografischen und sozialen Eigentümlichkeiten abstrahierten.
Die abstrahierenden, Universalisierungen vornehmenden Bestandteile des vereinigten utilitaristischen / rawlsianischen Wohlfahrtsdenkens, das die politische Entscheidungsfindung im späten 20. Jahrhundert dominiert hat, scheinen meinem Eindruck nach die blinden Flecke in Bezug auf Gesellschaft, Politik und politische Rechte hervorgebracht zu haben, die dafür verantwortlich sind, dass nicht nur 2008, sondern auch der Brexit, Trump und das Wiederaufleben des Rechtsradikalismus in Deutschland uns überrascht haben.
II. Eine Alternative für das 21. Jahrhundert
Lässt sich ein alternatives Paradigma für die politische Ökonomie erkennen, das uns nicht so anfällig für Überraschungen der Art macht, wie wir sie in jüngerer Zeit erlebt haben? Ich glaube ja, und zwar vor allem, wenn wir hinsichtlich der politischen Philosophie einen alternativen Weg verfolgen. Meiner Ansicht nach täte es unserem Gerechtigkeitsdenken gut, wenn wir anfingen, über politische Gleichheit nachzudenken.
Welcher Zusammenhang besteht zwischen Gerechtigkeit und politischer Gleichheit? Um eine Antwort auf diese Frage zu finden, müssen wir uns die Zeit nehmen, den Begriff der Gleichheit und deren verschiedenen Ausdrucksformen zu überdenken. Meiner Erfahrung nach nehmen sich normalerweise nur sehr wenige von uns die Zeit herauszufinden, welcher Zusammenhang zwischen den verschiedenen Arten von Gleichheit besteht. Fangen wir also mit einer grundlegenden Liste an: Es gibt eine moralische Gleichheit unter Menschen, es gibt politische Gleichheit, es gibt soziale Gleichheit oder ökonomische Gleichheit bzw. ökonomischen Egalitarismus, und die Liste ließe sich beliebig fortsetzen. Es gibt zum Beispiel auch Rassengleichheit und Gleichheit der Geschlechter und so weiter. In welchem Verhältnis stehen alle diese Gleichheitskategorien zueinander?
[…]
- ^ Elizabeth Popp Berman, »Thinking like an Economist. On Expertise and the U.S. Policy Process«, in: Occasional Paper Series, Institute for Advanced Study, Paper Nr. 52, 2014, https://www.sss.ias.edu/files/papers/paper52.pdf, zuletzt aufgerufen am 30.1.2020.
Auszug aus:
Danielle Allen, Politische Gleichheit
Frankfurter Adorno-Vorlesungen 2017
Aus dem Amerikanischen von Christine Pries
© Suhrkamp Verlag
ISBN 978−3−518−58751−5
suhrkamp.de
Danielle Allen (*1971 Takoma Park) is a classicist, political scientist, and professor at Harvard University. She studied at Princeton University, Harvard University, and at King‘s College, University of Cambridge, where she received her PhD in Classics. She has also taught at the School of Social Science at Princeton and at the University of Chicago. Danielle Allen has published primarily in the areas of democratic theory, political sociology and political history. Her research interests include theories of equality and social justice in ancient Athens, as well as with regard to modern America. Allen achieved rising prominence in the German-speaking area when she was appointed to give the Frankfurt Adorno Lecture in 2017. She was also awarded the prestigious John W. Kluge Prize for Scholarship in 2020. Publications include Political Equality (2020); Toward a Connected Society (2016); Education, Democracy and Justice (2013); and Why Plato Wrote (2010), among others.